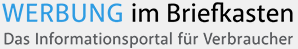„Senioren berichten immer häufiger, dass sie ihre Hausärzte verlieren“, sagt Jochen Windheuser, stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises Gesundheit und Pflege in der Seniorenvertretung Bremen. Denn im Schnitt seien die Hausärzte überaltert und gingen in Rente – und zudem seien sie höchst ungerecht verteilt: „Problemstadtteilen in Randlage, etwa Blumenthal, droht eine Katastrophe. Ältere Menschen sind nicht beliebig mobil.“ Die Unterversorgung mit Hausärzten in oft sozial schwächeren Stadtteilen betrifft aber alle Generationen.

Jochen Windheuser vom Seniorenbeirrat beklagt die Unterversorgung besonders für ältere Menschen in bestimmten Stadteilen. Foto: privat
Nicht alle Hausärzte nach Schwachhausen
Die Steuerung der hausärztlichen Versorgung durch die kassenärztliche Vereinigung müsse kleinteiliger werden, „damit nicht alle Praxen nach Schwachhausen streben“, sagt Windheuser. Der Seniorenvertreter meint auch, dass die bekannte Arztpraxis – auch wegen hoher Belastung – nicht mehr zeitgemäß sei. Insbesondere junge Medizinerinnen bräuchten moderne Arbeitsplätze: „Dies bieten Medizinische Versorgungszentren in kommunaler oder freigemeinnütziger Trägerschaft, gern angebunden an Kliniken, wie jüngst in der Neustadt eröffnet und erfolgreich.“ Medizinische Versorgungszentren (MVZ) als private Investorenmodelle allerdings lösten das Problem nicht, sondern verschärften es nur, ist Windheuser sicher. Der Seniorenpolitiker verweist auch auf das am Start befindliche MVZ in Bremerhaven, getragen von der Kassenärztlichen Vereinigung und den Krankenkassen. Auch bestimmte Praxisgemeinschaften bemühten sich, Lücken in der Versorgung zu schließen.
Kristin Viezens, Sprecherin des Gesundheitsressorts erklärt die Hintergründe der ungerechten Verteilung der Arztpraxen im Stadtgebiet: „Das Instrument zur Steuerung der ambulanten medizinischen Versorgung ist die kassenärztliche Bedarfsplanung.“ Diese legt seit 1977 fest, wie viele Kassen- beziehungsweise Vertragsärzte je Arztgruppe auf wie viele Einwohner kommen dürfen.
Einflussmöglichkeiten der Senatorin seien gering
Grundsätzlich brauche Bremen mehr Hausärztinnen und -ärzte, sagt Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard. Sie erklärt: „In Bremen gibt es Stadtteile, in denen faktisch eine Unter- beziehungsweise Überversorgung vorliegt, auch wenn im gesamten Planungsbezirk Bremen der Bedarf entsprechend der Berechnung der Kassenärztlichen Versorgung gedeckt zu sein scheint.“ Wegen dieser ungleichen Verteilung setze sich das Gesundheitsressort auf Bundesebene für eine kleinräumigere Bedarfsplanung und eine Überarbeitung der Bedarfsplanungsrichtlinie ein. „Unsere Einflussmöglichkeiten als Gesundheitsbehörde sind in diesem Zusammenhang sehr begrenzt beziehungsweise kaum vorhanden, da hier die Selbstverwaltung, also vor allem die Kassenärztliche Vereinigung, gefragt ist“, entschuldigt sie.
Beschleunigung der Anerkennung ausländischer Heilberufe
Lösungsmöglichkeiten habe sie aber schon auf den Weg gebracht: „Das Gesundheitsressort bietet bereits Maßnahmen zur Ärztegewinnung und -ausbildung an, die auch gut angenommen werden: Etwa Zuwendungen an Studentinnen und Studenten, die ihr Praktisches Jahr an einer allgemeinmedizinischen Lehrpraxis im Land Bremen absolvieren, oder die Beschleunigung des Anerkennungsverfahrens ausländischer Heilberufe.“ Medizinischen Versorgungszentren halte sie für eine wichtige Ergänzung, um vorhandene regionale Versorgungslücken zu schließen. Ihrer Ansicht nach müsste Gesundheitsversorgung allerdings grundsätzlich breiter gedacht werden, so Bernhard weiter.
„Viele Ärztinnen und Ärzte wollen nicht mehr 60 bis 70 Stunden pro Woche arbeiten, und sie wollen auch häufig nicht die wirtschaftliche Verantwortung tragen.“ Eine Idee seien kommunale Gesundheitszentren, in denen es niedrigschwellige Angebote gibt. Dort könne man von Gesundheitsfachkräften umfassend beraten oder beispielsweise von Public Health Nurses dann behandelt werden, wenn nicht sofort Mediziner draufschauen müssen. Zum anderen sind weitere MVZ für Ärztinnen und Ärzte in Anstellung in Planung, „und zwar in Quartieren mit weniger niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten“.


 Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard versucht, Lösungen für die fehlenden Hausarztpraxen zu finden. Foto: Schlie
Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard versucht, Lösungen für die fehlenden Hausarztpraxen zu finden. Foto: Schlie