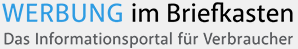Weser Report: Herr Wecker, die Texte Ihres neuen Albums Utopia und ihrer Utopia-Tournee sind noch politischer als Ihre früheren Lieder. Wie kommt es dazu?
Konstantin Wecker: Ich habe mich in den letzten Jahren noch eingehender mit dem Thema Utopie beschäftigt und habe verschiedene Denkerinnen und Denker gelesen. Die Lieder auf dem Album sind mir aber erst im letzten Jahr eingefallen, also zugeflogen.
Wie sehr kann Musik, können Songs die Politik beeinflussen?
Es gibt natürlich keinen Einfluss auf die real existierende und praktizierende Politik, aber es gibt einen jahrtausendlangen Einfluss der Kultur auf die Politik. Die Kultur träumt seit Jahrtausenden von einer herrschaftsfreien Welt. Da bin ich mir sicher.
Auf ihrem neuen Album haben Sie auch eine neue Version ihres 1977 erstmals vorgetragenen Liedes Willy. Ein Lied gegen Nazis und Neonazis. Frustriert es Sie nicht, dass Sie immer noch oder schon wieder darüber singen müssen?
Natürlich ist es frustrierend, aber gleichzeitig ist da auch immer die Hoffnung, dass sich was ändern wird. Als ich den Willy 1977 schrieb, gab es ein paar Neonazis, heute sitzen welche im Parlament. Gerade für die Jungen ist es so wichtig, noch einmal deutlich zu machen, wie grausam die NS-Zeit war und dass sie sich nicht mehr wiederholen darf. Esther Bejarano, die Holocaust-Überlebende, mit der ich immer wieder auf der Bühne stand, hat so treffend gesagt: Faschismus ist keine Meinung, Faschismus ist ein Verbrechen.
Alle leben nur im Jetzt, ohne Ehrgeiz, ungehetzt: So besingen Sie in ihrem Lied Utopia einen wünschenswerten Zustand. Doch am Anfang des Albums tragen Sie ein Gedicht vor mit dem Titel. Prolog Faust. In Goethes Faust heißt es allerdings: Wenn ich zum Augenblick sage: Verweile doch, du bis so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Das ist doch ein Widerspruch zu Ihren Zeilen.
Prolog Faust ist ein Gedicht, das mich wie alle meine Gedichte tief bewegt hat, weil es mich über mein Inneres aufklärt. Ich denke mir meine Gedichte nicht aus, sie passieren mir. Poesie ist nicht rational, sie passiert. Ich werde immer wieder überrascht von meinen eigenen Texten. Und dieses Gedicht hab ich Faust genannt, weil ich Goethe zitiere mit dem Satz: „Was die Welt im Innersten zusammenhält.“
Was ist daran erstrebenswert, nur im Jetzt zu leben und damit nichts Neues mehr kennenzulernen?
Wirklich Neues kann man nur kennenlernen, wenn man in so einem Zustand ist. Denn was wir oft als neu betrachten, ist ja etwas, was uns von außen angetragen wird. Aber das wirklich Neue liegt bei jedem in der Tiefe seiner selbst.
Tieftraurig ist dagegen Ihr Stück mit dem Titel: Die Tage grau. Was war der Anlass?
Demenz. Ich habe mich lange geweigert, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dass ich es jetzt doch tue, hat mit der Neuropsychologin Sarah Straub zu tun, die eine sehr schöne CD mit Neuinterpretationen meiner Lieder aufgenommen hat und in der Demenzforschung tätig ist.
Glücksbesoffen ist auch ein wichtiger Begriff auf Ihrem Album. Wann waren Sie zuletzt glücksbesoffen?
Vor Corona auf der Bühne und jetzt wieder, wenn ich mit Utopia auf die Bühne komme. Die Bühne gehört einfach zu mir. Ich bin jetzt seit 50 Jahren auf der Bühne und vor Corona habe ich jedes Jahr wenigstens 100 Konzerte gegeben, auch in Zeiten, in denen es mir bekanntermaßen schlecht ging. Da bin ich auf die Bühne gegangen, damit es mir besser ging. Die Bühne hat schon einen Suchtfaktor.
Brauchen Sie die Anerkennung durchs Publikum?
Jeder Mensch braucht Anerkennung. Aber das ist es gar nicht so. Es ist das Gemeinsame. Ich habe mit meinem Publikum eine gemeinsame Sehnsucht. Das ist schön. Du bist mit deinen Gedanken alleine und kommst dann auf die Bühne und hast Hunderte, manchmal Tausende, die die gleichen verrückten Ideen haben wie ich. Das macht Mut.
Wie hat sich im Laufe Ihrer langen Karriere das Publikum verändert?
Natürlich ist es mit mir gealtert. Aber manchmal kommen auch Ältere mit ihren Kindern und Enkeln, meistens sind es Frauen, die ihre Kinder oder Enkel mitbringen. Ich erreiche aber auch jüngere Generationen. Manche sagen: Ich musste als Kind auf der Fahrt in den Urlaub immer deine Kassetten hören, jetzt will ich dich live erleben.
Wie haben sich Ihre Songs geändert?
Ich musste immer darauf warten, dass mir Gedichte passieren, dann habe ich sie vertont. Ich habe nie auf bestehende Musik Texte gemacht, sondern immer ganz klassisch Texte vertont. Ich komme ja von der klassischen Musik.
Sie sprechen und singen oft von Herrschaft, ohne sie genau zu definieren. Was ist für Sie Herrschaft?
Herrschaft hat mit herrschen zu tun, mit Herr, mit Patriarchat. Viele haben versucht, die Welt unter ihre Macht zu bekommen. Es gibt wenige Politiker, die keine Macht ausüben wollen wie die von mir sehr verehrte Petra Kelly.
Wer regieren will, braucht Macht.
Ich meine, dass man die Macht in einem selbst immer bekämpfen muss. Als ich in jungen Jahren plötzlich vor Hunderten, dann vor Tausenden gespielt habe, merke ich als Künstler schon, dass auch ich Macht ausüben kann.
Ist es nicht eine Versuchung, vor Tausenden statt nur vor Hunderten?
Da war mein künstlerischer Impuls immer größer. Ich haben schon als 19-Järhiger das Motto gehabt: Ich singe, weil ich ein Lied hab und nicht, weil es euch gefällt. An der Hochschule habe ich den Studierenden gesagt: Wenn Ihr ein Lied habt und was sagen wollt, dann kommt zu mir. Aber wenn Ihr berühmt und reich werden wollt, dann müsst Ihr zu Dieter Bohlen gehen.


 „Utopia“ heißt das neue Album von Konstantin Wecker, einem der bedeutendsten deutschen Liedermacher. „Utopia“ heißt auch seine Tournee, auf der er am 26. November dieses Jahres nach Bremen kommt und in der Glocke auftritt.Foto: Thomas Karsten
„Utopia“ heißt das neue Album von Konstantin Wecker, einem der bedeutendsten deutschen Liedermacher. „Utopia“ heißt auch seine Tournee, auf der er am 26. November dieses Jahres nach Bremen kommt und in der Glocke auftritt.Foto: Thomas Karsten