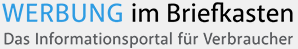Lebend- oder Pusztarupf – Tot- oder Schlachtrupf – Daunensammeln
Daunen oder Dunen sind nach wie vor sehr gefragt: für Kissen, Bettdecken, Schlafsäcke und Bekleidung. Für die Industrie gewonnen werden diese auch Flaum- oder Unterfedern genannten Plumula entweder durch die schmerzhafte und in Deutschland verbotene Prozedur des „Lebend- oder Pusztarupfes“ von Vögeln in Massentierhaltung oder durch das „Tot- oder Schlachtrupfen“ von zuvor für die Nahrungsmittelindustrie getöteten Tieren. Die Daunen der Eiderente, einer ursprünglich ausschließlich an der arktischen Küste des Atlantiks und Pazifiks wild lebenden Meeresente, werden hingegen nach der Brut im natürlichen Lebensraum einfach aufgesammelt.
Deutschland importiert jährlich etwa 10.000 Tonnen Daunen aus aller Welt
Das Daunengewicht ist abhängig von der Vogelart und -rasse sowie vom individuellen Alter der Vögel. Ein Kilogramm Gänsedaunen enthält etwa 250.000 bis 400.000 Daunen, während von den feinsten und zugleich leichtesten Daunen der Eiderente rund 500.000 bis zu einer Million Daunen für ein Kilogramm gesammelt werden müssen. Jedes Jahr importiert Deutschland etwa 10.000 Tonnen Daunen aus aller Welt.
Beim Lebendrupf wird Vögeln Teil ihres Federkleides unter Schmerzen aus dem Körper gerissen
„Beim Lebendrupf wird das Unterkleid der in Gefangenschaft lebenden Gänse bei vollem Bewusstsein an Hals, Rücken, Bauch und Brust bis zu viermal in ihrem ohnehin kurzen Leben herausgerissen, so die Bremer Tierschutz- und Wildtier-Expertin Dr. K. Alexandra Dörnath, die die Tierarztpraxis Klein Mexiko und das Exoten-Kompetenz-Centrum leitet. „Bei Zuchttieren kann dies sogar bis zu sechzehnmal sein. Viele Daunenjacken sind aus Sicht des Tierschutzes also quasi die Nachfolge bestimmter Pelzmäntel – in beiden Fällen gilt: Tierleid für die Welt der Mode“, betont die engagierte Tierschützerin.

Eiderdaunen schützen die Tauchenten (hier ein Erpel) vor der eisigen Kälte und den Winden des nördlichen Klimas – und halten beim Tauchen warm. Foto: Bollmann
Nach Schilderung des Deutschen Tierschutzbundes sei Rupfen Akkordarbeit. Bis zu 3000 Tiere würden in fünf Stunden per Hand gerupft und Vogelindividuen dabei oft verletzt. Schwerste Wunden, gebrochene Beine und Flügel und sogar sterbende Vögel gehörten demnach zum Alltag in der Industrie. „Auch das sogenannte Raufen, bei dem Daunen während der Mauser, dann nämlich sitzen diese locker, entnommen werden, ist grundsätzlich durch Leiden, Schäden und Schmerzen für die betroffenen Tiere gekennzeichnet, da der Zeitpunkt meist nicht richtig getroffen wird und dies bei der industrialisierten Arbeit meist nicht tierschutzkonform abläuft“, so die Tierärztin. „Niemals sollten lebenden Tieren Federn entnommen werden“, betont die Expertin.

Die Graugans ist der Vorfahr der Hausgans, der beim Lebendrupf die Federn bei vollem Bewusstsein herausgerupft werden. Dies ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Foto: Bollmann
Enten werden meist nach der Schlachtung maschinell gerupft
„Bei Enten werden die Daunen in der Regel erst nach der Schlachtung und meist maschinell gerupft“, weiß Dörnath. Das habe allerdings nichts mit Tierschutz zu tun, sondern sei dem Umstand geschuldet, dass es für den Daunenbedarf genug geschlachtete Enten, beispielsweise in China, gäbe.
Für Eiderdaunen werden Enten nicht gequält, wohl aber Polarfüchse erschossen
In Island werden jährlich etwa 3.000 Kilogramm Eiderdaunen aus den Nestern gesammelt und zu hochwertigen Kleidungsstücken und Decken verarbeitet. Zum Schutz der Eiderenten werden allerdings unzählige Polarfüchse getötet. „In Wahrheit geht es hierbei gar nicht um den Schutz dieser Meeresenten, sondern es geht um das Geld, das die Daunen bringen“, betont Dörnath. Fürsorglich kümmern sich isländische Farmer um wilde Eiderenten und bekommen dafür deren kostbare Federn. Doch die tierfreundliche Praxis hat eine blutige Kehrseite. Zwar würden für Jacken aus Eiderdaunen die Enten nicht gequält, aber aus ökonomischen Gründen massenhaft Polarfüchse erschossen. „Dies ist ein Lehrstück über unser verdrehtes Verhältnis zur Natur“, so Dörnath.

Tierfreundlich: Pflanzenfasern (hier: Baumwolle) werden ohne Tierqual gewonnen. Die flaumigen Hohlfasern der Schoten des Kapokbaumes heißen Pflanzendaunen. Foto: Juan Pablo Gonzales Delgado, Pixabay
Pflanzliche Alternativen: „Pflanzendaunen“
„Wer sich nicht mit fremden Federn wärmen und sicher gehen will, dass er ethisch korrekte Wintermode trägt und ebensolche Decken, Kissen und Schlafsäcke nutzt, greift am besten auf pflanzliche Alternativen zurück. So gibt es die Fasern des Kapokbaumes, auch ,Pflanzendaunen‘ genannt, aber auch die Fasern von Seidenpflanzen- und von Wollbaumgewächsen“, weiß Dörnath. Die Expertin verweist darauf, dass synthetische Fasern zwar Alternativen, diese aber nicht biologisch abbaubar seien. Daunen, Federn und Pflanzenfasern hingegen könnten später als Dünger genutzt oder für die Wärmedämmung verwendet werden.
Viele Siegel sind leider wertlos
„Wer unbedingt Kleidung oder Decken mit Daunen kaufen möchte, möge zumindest auf zertifizierte Produkte setzen“, so Dörnath. Die enthaltenen Daunen sollten unter den strengsten verfügbaren Tierschutz- und Rückverfolgbarkeitsstandards, wie dem Global Traceable Down Standard (TDS) und dem Responsible Down Standard (RDS), vollständig kontrolliert, geprüft und entsprechend zertifiziert sein“, erklärt die Veterinärin. Für die Verbraucher sei allerdings häufig aufgrund nicht vorhandener firmenunabhängiger Gütesiegel zur Daunenherkunft nicht immer erkennbar, ob als „aus Totrupf“ deklarierte Ware tatsächlich aus entsprechenden Betrieben stamme und ob möglichst tiergerecht mit dem Geflügel umgegangen wurde oder nicht. „Viele dieser Siegel sind leider wertlos“, so die Tierschützerin Dörnath.

Die Expertin Dr. Alexandra Dörnath aus der Tierarztpraxis Klein Mexiko. Foto: Bollmann
Falls Ihnen ein Thema rund um einheimische Wildtiere und auch Exoten unter den Nägeln brennt, schreiben Sie uns einfach unter martin.bollmann@weserreport.de eine Mail. mb


 Eine Eiderente polstert ihr Nest mit ihren weichen Daunen aus. Die Federn müssen nach der Brut nur aufgesammelt werden. Foto: Jonathan Cannon, Pixabay
Eine Eiderente polstert ihr Nest mit ihren weichen Daunen aus. Die Federn müssen nach der Brut nur aufgesammelt werden. Foto: Jonathan Cannon, Pixabay